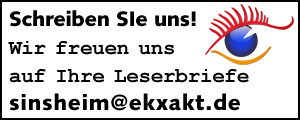Die Privatinsolvenz wird auch als Verbraucherinsolvenz bezeichnet und ist ein vereinfachtes Insolvenzverfahren für Privatpersonen
Sie soll die Gläubiger gleichmäßig bedienen, aber dem Schuldner auch helfen, wieder schuldenfrei zu sein. Kann eine Privatperson ihre Schulden nicht mehr begleichen, ist eine Privatinsolvenz eine Lösung. Sie ist für denjenigen, der sie beantragt, mit starken Einschränkungen und Konsequenzen verbunden, kann aber auch eine Chance für einen Neuanfang sein. Die Privatinsolvenz schützt den Schuldner vor Pfändungen und sichert ihm einen bestimmten Betrag zu, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Am Ende einer Privatinsolvenz erfolgt eine Restschuldbefreiung.
Wer kann eine Privatinsolvenz beantragen?
Eine Privatinsolvenz können Privatpersonen beantragen, die mit ihrem Einkommen und dem vorhandenen Vermögen ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Nur natürliche Personen, die Verbraucher, können eine Privatinsolvenz beantragen.
Eine Privatinsolvenz kann nicht von Freiberuflern und Selbstständigen beantragt werden. Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige können jedoch eine Regelinsolvenz beantragen, für die andere Regelungen und Voraussetzungen als für die Privatinsolvenz gelten. Es gibt für Selbstständige jedoch eine Ausnahme. Beschäftigen sie nicht mehr als 19 Mitarbeiter und bestehen keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen, können auch Selbstständige Privatinsolvenz beantragen. Privatinsolvenz ist auch für ehemalige Selbstständige möglich, die beispielsweise ihre Selbstständigkeit zugunsten eines Angestelltenverhältnisses aufgegeben haben.
Rentner, aber auch Empfänger von Arbeitslosengeld oder Bürgergeld können Privatinsolvenz beantragen und wieder schuldenfrei werden. Rentner können bei Privatinsolvenz ihren Ruhestand genießen und müssen keine Arbeit annehmen. Für Empfänger von Arbeitslosengeld I und Bürgergeld gilt jedoch, dass sie sich aktiv um eine Arbeitsstelle bemühen und eine zumutbare Arbeitsstelle annehmen. Finden sie keine zumutbare Arbeitsstelle, können sie trotzdem schuldenfrei werden.
Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz
In Paragraf 305 der Insolvenzordnung (InsO) sind die Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz festgelegt:
-
Antragsteller muss eine natürliche Person sein
-
der Antragsteller kann seine Schulden mit dem vorhandenen Vermögen und seinem Einkommen nicht mehr begleichen und ist zahlungsfähig
-
eine selbstständige Tätigkeit darf nicht ausgeübt werden
-
der Schuldner muss zu Beginn des Verfahrens seinen Wohnsitz in Deutschland haben
-
ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den Gläubigern muss gescheitert sein, was durch eine anerkannte Stelle bescheinigt werden muss
Für eine Privatinsolvenz muss der Schuldner nicht über ein Einkommen in einer bestimmten Höhe verfügen. Auch eine Schuldenhöhe ist nicht vorgeschrieben.
Dauer des Insolvenzverfahrens
Wer nach dem 1. Oktober 2020 eine Privatinsolvenz beantragt, kann nach drei Jahren schuldenfrei werden. Zuvor dauerte eine Privatinsolvenz sechs Jahre. Die ursprüngliche Verfahrensdauer von sechs Jahren verkürzt sich monatsweise, wenn das Verfahren zwischen dem 17. Dezember 2019 und dem 30. September 2020 beantragt wurde.
Es ist möglich, nach einer Restschuldbefreiung eine weitere Privatinsolvenz zu beantragen. Allerdings muss die Restschuldbefreiung mindestens elf Jahre zurückliegen. Wird eine erneute Privatinsolvenz beantragt, dauert das Verfahren nicht drei, sondern fünf Jahre.
Ein Schuldner kann eine Privatinsolvenz vorzeitig beenden, wenn sich während der Wohlverhaltensphase seine Vermögensverhältnisse ändern und er die Schulden begleichen kann. Das ist möglich, wenn der Schuldner Vermögen geerbt hat. Auch dann, wenn der Schuldner einen erneuten Einigungsversuch mit seinen Gläubigern unternimmt und mit den Gläubigern eine Einigung erzielt, kann das Insolvenzverfahren vorzeitig beendet werden. Nach der Eröffnung des Verfahrens sind die Gläubiger mitunter eher zu einer Einigung bereit als vorher.
Ablauf einer Privatinsolvenz
Bevor das Verfahren einer Privatinsolvenz eröffnet werden kann, muss der Schuldner versuchen, mit seinen Gläubigern eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Gelingt das nicht, müssen eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle, eine Verbraucherzentrale oder ein Rechtsanwalt das Scheitern der außergerichtlichen Einigung bescheinigen. Die Stelle, die das Scheitern bescheinigt, stellt den Insolvenzantrag mit den dazugehörigen Unterlagen beim zuständigen Insolvenzgericht.
Die Privatinsolvenz läuft folgendermaßen ab:
-
Ein Schuldenbereinigungsplan wird erstellt, der jedoch nur in wenigen Fällen angenommen wird. Bei Annahme des Schuldenbereinigungsplans erfolgt ein Vergleich.
-
Wird der Schuldenbereinigungsplan nicht angenommen, muss der Schuldner zusammen mit seinem Berater einen Antrag ausfüllen und beim Insolvenzgericht einreichen.
-
Das Insolvenzgericht eröffnet das Verfahren. Es prüft, ob die Verfahrenskosten gedeckt sind.
-
Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird ein Treuhänder für den Schuldner bestimmt.
-
An die Eröffnung des Verfahrens schließt sich die Wohlverhaltensphase an. Der Schuldner darf in dieser Phase keine neuen Schulden mehr machen, da das Gericht sonst die Restschuldbefreiung versagen könnte.
-
Der Schuldner muss in der Wohlverhaltensphase den pfändbaren Anteil seines Einkommens an den Treuhänder abführen. Er hat die Pflicht zur Arbeit oder muss, wenn er arbeitslos ist, den Nachweis erbringen, dass er sich um Arbeit bemüht und eine zumutbare Arbeitsstelle nicht abgelehnt hat. Sollte Vermögen vorhanden sein, wird es verwertet, um die Schulden zu begleichen.
-
Die Privatinsolvenz endet mit der Restschuldbefreiung durch das Gericht.
Welche Schulden werden durch die Privatinsolvenz erlassen?
Mit der Restschuldbefreiung werden alle Schulden erlassen, die noch offen sind und mit der Abführung des pfändbaren Anteils vom Einkommen und der Verwertung des vorhandenen Vermögens nicht getilgt werden konnten. Es spielt keine Rolle, wie hoch diese Restschuld ist. Davon ausgenommen sind jedoch Schulden aus Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Diese Schulden bleiben bestehen. Das gilt auch für Steuerschulden, die durch Steuerhinterziehung entstanden sind. Diese Schulden müssen nach Ende des Verfahrens beglichen werden.